Warten - ein Erlebnisbericht
Mir ist seit Sonntag kontinuierlich schwindlig. Ich kann Fahrrad fahren und geradeaus gucken, aber es fühlt sich nicht so an. Der Hausarzt schickt mich zum HNO.
Es ist in diesem Wartezimmer seit einer Stunde nicht vorangegangen. Es sind neun Leute vor mir dran. Ich habe meine Wasserflasche vergessen, genau wie etwas zu lesen. Von den neun Leuten sind vier Kinder. Ich habe schon zwei ausführlichen Diskussionen lauschen dürfen, ob Papa oder Mama mit auf Toilette soll, weil das Kind groß muss und do-hoch, da soll jemand helfen, nein, Papa soll, nicht Mama, und dann soll das Kind rufen wenn es fertig ist und dann ruft es erst, dass es warten muss, weil schon jemand da ist, und dann ruft es nochmal, weil es jemanden pullern hören kann, und dann nochmal, als es selber pullert. Die Wartezimmerbevölkerung blickt den gesamten Austausch hindurch kollektiv teilnahmslos zu Boden.
Hier macht man was mit.
Es gehen zwei Leute. Es sind noch neun vor mir.
Eine Mutter schreibt mit ihrem Kind ein Diktat. Sie legt dabei eine bemerkenswerte Ungeduld an den Tag, und das sage ich als weitbekannter Undulder. "Boah, schreib noch noch größer, hörst du? Weiter, also: Kläähklich rollte der Ball hinter das Tor, hast du gehört, kläähklich, hab ich extra betont, so. Wie weit bist du? Die anderen Kinder, die. Anderen. Kinder. Nichts stopp, machst du das bei deiner Lehrerin auch so? Warten Sie mal kurz, echt? Das machst du?"
"Die macht das aber tausdendmal langsamer."
"Ja, du bist aber auch langsam. So, zeig mal her, gib den Stift. Mensch, du krakelst hier aber rum. Die Ande-renn, hab ich gesagt, nicht andern, hast du nicht zugehört?"
Eine andere Frau lauscht mit tiefen Zornesfalten im Gesicht. Immer, wenn die Mutter das Kind ansieht, wird sie heimlich mit dem bösen Blick bedacht.
Es wird jemand aufgerufen. Sie kommt aus einem Nebenraum, von dem ich bislang annahm, dass er zu den Toiletten führen würde, da vorhin Kinder durch die entsprechende Tür verschwunden sind. Neun Leute sind noch vor mir.
Der Mann neben mir schiebt seine dritten Zähne hin und her. Ich stelle mir vor, ihn aus dem Nichts heraus anzuschreien, er solle das bleiben lassen, und danach weiterzuschreiben, als sei nichts passiert.
Es gibt einen Wasserspender. Seit das Diktat beendet ist, herrscht Totenstille. Ich wage nicht, mich zu rühren.
Ein Kind wird aufgerufen. Es liest noch. Die Mutter fragt, ob es gerade sehr spannend sei. Das Kind liest. Und liest. Und liest.
Schließlich steht es auf, geht zum Mülleimer, der direkt neben dem außerordentlich verlockenden Wasserspender steht, spuckt etwas aus und verkündet: "Fertig!" Die beiden gehen, also, Kind und Mutter, nicht Kind und Wasserspender. Oder Mülleimer.
Es wird jemand aufgerufen. Niemand erscheint aus dem Nebenraum, stattdessen steht jemand auf, der bereits von Anfang an hier saß. Von Anfang an, das ist mittlerweile fast zwei Stunden her. Es sind noch sechs Leute vor mir dran. In mir keimt Hoffnung.
Ich beginne zu vermuten, dass die Frau mit den Zornesfalten vielleicht einfach so aussieht. Diktatmutter und Diktatkind sind lange verstummt, aber die Falten sind immer noch da.
Der Mann neben mir knirscht nicht mehr mit den Zähnen, aber schaut bereits zum zehnten Mal auf die Uhr. Auch sonst kann er die Hände nicht stillhalten. Sein Ärmel weist einen Fettfleck auf, wo er beharrlich daran herumzuppelt. Er streicht seine Hosen glatt, zieht dann am Knie am Stoff, so dass eine Falte entsteht. Diese streicht er dann wieder glatt. Erneut schaut er auf die Uhr. Mein Handy ist längst den Akku-Tod gestorben, ich habe keine Möglichkeit mehr, die Zeit zu bestimmen. Ich binn versucht, dem Mann auf die Uhr zu sehen, wenn er den Arm das nächste Mal hebt. Jetzt. Er streicht sich das Kinn. Ich schaue trotzdem nicht. Feigling.
Der junge Mann auf der anderen Seite wird aufgerufen. ICh bin ein wenig enttäuscht - er hatte ein interessantes Muttermal am Hals. Ein Rohrschachtest to-go. Zornesfalte, Diktatmutter/-Kind oder Zuppelmann wären mir lieber gewesen. Noch vier Leute vor mir, aber ich gehe davon aus, dass Diktatmutter und Kind zusammengehören. Also drei.
Ich überwinde mich und ziehe meine Jacke aus. Die erste Stunde war mir noch kalt, aber ein Wintermantel über Sommerjacke über zwei Hemden entfalten doch irgendwann ihre Wirkung.
Zuppelmann hat sich kaum noch unter Kontrolle. Die Finger bewegen sich unaufhörlich, aber auch die Beine streckt er jetzt alle paar Sekunden aus oder winkelt sie an. Sitzen wird ihm wohl unbequem. Es geht mir maßlos auf den Keks.
Es kommt jemand herein (zum Spritzen - was auch immer da konkret gespritzt wird) und beginnt, sich lautstark mit Zornesfalte zu unterhalten. Auch das geht mir maßlos auf den Keks.
Zuppelmann zuppelt, sieht auf die Uhr, sagt laut: "Puuuh." Ich hasse, dass er neben mir sitzt. Mittlerweile sind viele Plätze frei, dennoch sitzt er direkt neben mir. Er zieht die Socken hoch, streift die Hose glatt, verschränkt die Arme, dreht die Daumen. Dann zuppelt er eine Falte in die Hose, die er sofort wieder glatt zieht.
Spritze wird aufgerufen. Mutter Diktat beschreibt fein aufgeschlüsselt ihre Wochenpläne, inklusive welchen Bus sie wohin nehmen wird. Kind Diktat hört aufmerksam zu und stellt Rückfragen.
Rohrschach kehrt zurück, gewährt mir einen letzten Blick auf seinen Hals, zieht eine Jacke an und geht.
Zuppelmann heißt Herr Waack. Er ist schon halb beim Doktor, ehe dieser seinen Namen vollständig aufgerufen hat, obwohl er nur eine Silbe hat. Ich atme auf.
Spritze ist zurück und beginnt, auf ihrem Handy herumzuspielen.
Mit Ablegen meines Mantels habe ich mir einen Becher Wasser besorgt. Ich erwähne das erst jetzt, weil er jetzt erst trinkbar ist. Er steht seit einer halben Stunde auf der Heizung. An der Außenseite kondensiert immer noch Luftfeuchtigkeit.
Rohrschachs Muttermal ähnelte dem Zentralnervensystem. Ein großes Oval (Hirn) mit ein wenig Gekräusel an der Unterseite (Kleinhirn) und einem langen, seitlich abgehenden Faden - dem Rückenmark. Auch eine Qualle käme in Frage, oder ein Klecks zerlaufender Farbe.
Zornesfalte wird aufgerufen. Jemand anders nimmt eine Jacke weg - wie sich herausstellt, verdeckte sie einen Sitzplatz, den ich übersehen haben muss. Doch noch jemand mehr hier.
Ein Kind kommt herein, legt die Sachen ab und setzt sich. Ein paar Minuten später - es schreibt auf seinem Handy - kommt die Schwester und fragt, ob es hier nur warte.
"Ja, erstmal schreib ich aber noch mit meiner Mutter."
"Das kannst du auch gleich weiter machen, aber gehst du dann auch in Behandlung?"
"Ja, danach."
"Und wie heißt du?"
"Julian."
"Und dein Familienname?"
Julian sagt es ihr. Im Warteraum verbreitet sich ein Lächeln. Das Kind bemerkt nichts Ungewöhnliches an diesem Austausch.
Der Mann, der sich hinter der Jacke verborgen hatte, erklärt der Schwester, sie hätte ihn einfach sitzen lassen sollen. "Ach", wehrt die Schwester ab. "Macht man so." - "Ja, naja. Nee."
Ein paar weitere Minuten später informiert die Schwester Julian, dass er erst in vier Wochen seine Spritze holen kann. Julian stört das nicht. Er möchte dennoch ein wenig bleiben und warten - wohl, bis die Mutter heimkommt.
Die Schwestern reden untereinander. Ein Buchtitel fällt nicht mehr ein. "Neue Schmerzen oder so".
"Die neuen Leiden des jungen Werther", verkündet Spritze hilfreich.
"Gibt's davon nicht zwei?"
"Ja, das eine ist neuer."
Julians Mutter ist der Meinung, er könne jetzt heimkommen, meint Julian und macht sich auf den Heimweg. Auch der Mann, der ihn gern hätte sitzen lassen, steht bald darauf auf und geht. Auf was er gewartet hat, ist unklar.
Die Pflanze am Fenster hat lila, halbdurchscheinende Blätter. Wo sie nicht durchscheinend sind, zeichnet sich eine grüne Struktur ab. Es sieht gar nicht mal schlecht aus.
Außer Spritze, Diktat und mir ist niemand mehr hier. Jedenfalls bis die Tür sich öffnet und zwei neue Leute hereinkommen. Dankenswerterweise wollen sie nur einen Termin - halt, nein. Eine davon will einen Termin, ein anderer hat bereits einen, nimmt Platz und schnürt seine türkisen Turnschuhe neu. Diktatkind heißt Pierre-Ryan. Ich denke schlecht von seiner Mutter.
Noch jemand fragt nach einem Termin. Hat sich schon zwei Monate gequält, kann nicht früh, und noch einen Monat warten erst recht nicht. Ist selbständig und kann sich auf keinen Fall freinehmen. Die Terminsuche ist ein Tauziehen.
Ich trinke den dritten Becher Eiswasser, aber was langsam fehlt, ist Nikotin. Die Praxis müsste bald schließen. Ich bin mit Turnschuh allein.
Auf dem Gelände, auf dem früher das Meli stand, wird bald gebaut, erzählt Spritze. Die Bäume und Hecken, die dort gefällt und entsorgt wurden, sollten anscheinden gar nicht weg. Jemand hat den Plan falschherum gehalten. Nun wird auf einer Seite neu gepflanzt.
"Und der Augensammler, soll ich dir ausrichten, sammelt wirklich Augen."
Schwester: "Ein bisschen eklig, aber spannend. Nee, ist schon cool."
Spritze ist jetzt endgültig weg. Turnschuh wird aufgerufen. Ich bin allein.
Ich hab einen verzögerten Erregungsabfall im linken Innenohr. Oder eine verringerte Erregbarkeit. Oder beides. Ich habe nicht genau zugehört, aber ich bin schon mal heilfroh, dass man etwas gefunden hat. Schwindel, das ist so ein Wischiwaschisymptom, da fühlt man sich ohnehin wie ein Simulant. Die Tabletten muss ich komplett selbst bezahlen (22,85€), aber in ein, zwei Wochen sollte alles wieder beim Alten sein. Dann darf ich nochmal zur Kontrolle. Man darf auf das Wartezimmer gespannt sein.
Es ist in diesem Wartezimmer seit einer Stunde nicht vorangegangen. Es sind neun Leute vor mir dran. Ich habe meine Wasserflasche vergessen, genau wie etwas zu lesen. Von den neun Leuten sind vier Kinder. Ich habe schon zwei ausführlichen Diskussionen lauschen dürfen, ob Papa oder Mama mit auf Toilette soll, weil das Kind groß muss und do-hoch, da soll jemand helfen, nein, Papa soll, nicht Mama, und dann soll das Kind rufen wenn es fertig ist und dann ruft es erst, dass es warten muss, weil schon jemand da ist, und dann ruft es nochmal, weil es jemanden pullern hören kann, und dann nochmal, als es selber pullert. Die Wartezimmerbevölkerung blickt den gesamten Austausch hindurch kollektiv teilnahmslos zu Boden.
Hier macht man was mit.
Es gehen zwei Leute. Es sind noch neun vor mir.
Eine Mutter schreibt mit ihrem Kind ein Diktat. Sie legt dabei eine bemerkenswerte Ungeduld an den Tag, und das sage ich als weitbekannter Undulder. "Boah, schreib noch noch größer, hörst du? Weiter, also: Kläähklich rollte der Ball hinter das Tor, hast du gehört, kläähklich, hab ich extra betont, so. Wie weit bist du? Die anderen Kinder, die. Anderen. Kinder. Nichts stopp, machst du das bei deiner Lehrerin auch so? Warten Sie mal kurz, echt? Das machst du?"
"Die macht das aber tausdendmal langsamer."
"Ja, du bist aber auch langsam. So, zeig mal her, gib den Stift. Mensch, du krakelst hier aber rum. Die Ande-renn, hab ich gesagt, nicht andern, hast du nicht zugehört?"
Eine andere Frau lauscht mit tiefen Zornesfalten im Gesicht. Immer, wenn die Mutter das Kind ansieht, wird sie heimlich mit dem bösen Blick bedacht.
Es wird jemand aufgerufen. Sie kommt aus einem Nebenraum, von dem ich bislang annahm, dass er zu den Toiletten führen würde, da vorhin Kinder durch die entsprechende Tür verschwunden sind. Neun Leute sind noch vor mir.
Der Mann neben mir schiebt seine dritten Zähne hin und her. Ich stelle mir vor, ihn aus dem Nichts heraus anzuschreien, er solle das bleiben lassen, und danach weiterzuschreiben, als sei nichts passiert.
Es gibt einen Wasserspender. Seit das Diktat beendet ist, herrscht Totenstille. Ich wage nicht, mich zu rühren.
Ein Kind wird aufgerufen. Es liest noch. Die Mutter fragt, ob es gerade sehr spannend sei. Das Kind liest. Und liest. Und liest.
Schließlich steht es auf, geht zum Mülleimer, der direkt neben dem außerordentlich verlockenden Wasserspender steht, spuckt etwas aus und verkündet: "Fertig!" Die beiden gehen, also, Kind und Mutter, nicht Kind und Wasserspender. Oder Mülleimer.
Es wird jemand aufgerufen. Niemand erscheint aus dem Nebenraum, stattdessen steht jemand auf, der bereits von Anfang an hier saß. Von Anfang an, das ist mittlerweile fast zwei Stunden her. Es sind noch sechs Leute vor mir dran. In mir keimt Hoffnung.
Ich beginne zu vermuten, dass die Frau mit den Zornesfalten vielleicht einfach so aussieht. Diktatmutter und Diktatkind sind lange verstummt, aber die Falten sind immer noch da.
Der Mann neben mir knirscht nicht mehr mit den Zähnen, aber schaut bereits zum zehnten Mal auf die Uhr. Auch sonst kann er die Hände nicht stillhalten. Sein Ärmel weist einen Fettfleck auf, wo er beharrlich daran herumzuppelt. Er streicht seine Hosen glatt, zieht dann am Knie am Stoff, so dass eine Falte entsteht. Diese streicht er dann wieder glatt. Erneut schaut er auf die Uhr. Mein Handy ist längst den Akku-Tod gestorben, ich habe keine Möglichkeit mehr, die Zeit zu bestimmen. Ich binn versucht, dem Mann auf die Uhr zu sehen, wenn er den Arm das nächste Mal hebt. Jetzt. Er streicht sich das Kinn. Ich schaue trotzdem nicht. Feigling.
Der junge Mann auf der anderen Seite wird aufgerufen. ICh bin ein wenig enttäuscht - er hatte ein interessantes Muttermal am Hals. Ein Rohrschachtest to-go. Zornesfalte, Diktatmutter/-Kind oder Zuppelmann wären mir lieber gewesen. Noch vier Leute vor mir, aber ich gehe davon aus, dass Diktatmutter und Kind zusammengehören. Also drei.
Ich überwinde mich und ziehe meine Jacke aus. Die erste Stunde war mir noch kalt, aber ein Wintermantel über Sommerjacke über zwei Hemden entfalten doch irgendwann ihre Wirkung.
Zuppelmann hat sich kaum noch unter Kontrolle. Die Finger bewegen sich unaufhörlich, aber auch die Beine streckt er jetzt alle paar Sekunden aus oder winkelt sie an. Sitzen wird ihm wohl unbequem. Es geht mir maßlos auf den Keks.
Es kommt jemand herein (zum Spritzen - was auch immer da konkret gespritzt wird) und beginnt, sich lautstark mit Zornesfalte zu unterhalten. Auch das geht mir maßlos auf den Keks.
Zuppelmann zuppelt, sieht auf die Uhr, sagt laut: "Puuuh." Ich hasse, dass er neben mir sitzt. Mittlerweile sind viele Plätze frei, dennoch sitzt er direkt neben mir. Er zieht die Socken hoch, streift die Hose glatt, verschränkt die Arme, dreht die Daumen. Dann zuppelt er eine Falte in die Hose, die er sofort wieder glatt zieht.
Spritze wird aufgerufen. Mutter Diktat beschreibt fein aufgeschlüsselt ihre Wochenpläne, inklusive welchen Bus sie wohin nehmen wird. Kind Diktat hört aufmerksam zu und stellt Rückfragen.
Rohrschach kehrt zurück, gewährt mir einen letzten Blick auf seinen Hals, zieht eine Jacke an und geht.
Zuppelmann heißt Herr Waack. Er ist schon halb beim Doktor, ehe dieser seinen Namen vollständig aufgerufen hat, obwohl er nur eine Silbe hat. Ich atme auf.
Spritze ist zurück und beginnt, auf ihrem Handy herumzuspielen.
Mit Ablegen meines Mantels habe ich mir einen Becher Wasser besorgt. Ich erwähne das erst jetzt, weil er jetzt erst trinkbar ist. Er steht seit einer halben Stunde auf der Heizung. An der Außenseite kondensiert immer noch Luftfeuchtigkeit.
Rohrschachs Muttermal ähnelte dem Zentralnervensystem. Ein großes Oval (Hirn) mit ein wenig Gekräusel an der Unterseite (Kleinhirn) und einem langen, seitlich abgehenden Faden - dem Rückenmark. Auch eine Qualle käme in Frage, oder ein Klecks zerlaufender Farbe.
Zornesfalte wird aufgerufen. Jemand anders nimmt eine Jacke weg - wie sich herausstellt, verdeckte sie einen Sitzplatz, den ich übersehen haben muss. Doch noch jemand mehr hier.
Ein Kind kommt herein, legt die Sachen ab und setzt sich. Ein paar Minuten später - es schreibt auf seinem Handy - kommt die Schwester und fragt, ob es hier nur warte.
"Ja, erstmal schreib ich aber noch mit meiner Mutter."
"Das kannst du auch gleich weiter machen, aber gehst du dann auch in Behandlung?"
"Ja, danach."
"Und wie heißt du?"
"Julian."
"Und dein Familienname?"
Julian sagt es ihr. Im Warteraum verbreitet sich ein Lächeln. Das Kind bemerkt nichts Ungewöhnliches an diesem Austausch.
Der Mann, der sich hinter der Jacke verborgen hatte, erklärt der Schwester, sie hätte ihn einfach sitzen lassen sollen. "Ach", wehrt die Schwester ab. "Macht man so." - "Ja, naja. Nee."
Ein paar weitere Minuten später informiert die Schwester Julian, dass er erst in vier Wochen seine Spritze holen kann. Julian stört das nicht. Er möchte dennoch ein wenig bleiben und warten - wohl, bis die Mutter heimkommt.
Die Schwestern reden untereinander. Ein Buchtitel fällt nicht mehr ein. "Neue Schmerzen oder so".
"Die neuen Leiden des jungen Werther", verkündet Spritze hilfreich.
"Gibt's davon nicht zwei?"
"Ja, das eine ist neuer."
Julians Mutter ist der Meinung, er könne jetzt heimkommen, meint Julian und macht sich auf den Heimweg. Auch der Mann, der ihn gern hätte sitzen lassen, steht bald darauf auf und geht. Auf was er gewartet hat, ist unklar.
Die Pflanze am Fenster hat lila, halbdurchscheinende Blätter. Wo sie nicht durchscheinend sind, zeichnet sich eine grüne Struktur ab. Es sieht gar nicht mal schlecht aus.
Außer Spritze, Diktat und mir ist niemand mehr hier. Jedenfalls bis die Tür sich öffnet und zwei neue Leute hereinkommen. Dankenswerterweise wollen sie nur einen Termin - halt, nein. Eine davon will einen Termin, ein anderer hat bereits einen, nimmt Platz und schnürt seine türkisen Turnschuhe neu. Diktatkind heißt Pierre-Ryan. Ich denke schlecht von seiner Mutter.
Noch jemand fragt nach einem Termin. Hat sich schon zwei Monate gequält, kann nicht früh, und noch einen Monat warten erst recht nicht. Ist selbständig und kann sich auf keinen Fall freinehmen. Die Terminsuche ist ein Tauziehen.
Ich trinke den dritten Becher Eiswasser, aber was langsam fehlt, ist Nikotin. Die Praxis müsste bald schließen. Ich bin mit Turnschuh allein.
Auf dem Gelände, auf dem früher das Meli stand, wird bald gebaut, erzählt Spritze. Die Bäume und Hecken, die dort gefällt und entsorgt wurden, sollten anscheinden gar nicht weg. Jemand hat den Plan falschherum gehalten. Nun wird auf einer Seite neu gepflanzt.
"Und der Augensammler, soll ich dir ausrichten, sammelt wirklich Augen."
Schwester: "Ein bisschen eklig, aber spannend. Nee, ist schon cool."
Spritze ist jetzt endgültig weg. Turnschuh wird aufgerufen. Ich bin allein.
Ich hab einen verzögerten Erregungsabfall im linken Innenohr. Oder eine verringerte Erregbarkeit. Oder beides. Ich habe nicht genau zugehört, aber ich bin schon mal heilfroh, dass man etwas gefunden hat. Schwindel, das ist so ein Wischiwaschisymptom, da fühlt man sich ohnehin wie ein Simulant. Die Tabletten muss ich komplett selbst bezahlen (22,85€), aber in ein, zwei Wochen sollte alles wieder beim Alten sein. Dann darf ich nochmal zur Kontrolle. Man darf auf das Wartezimmer gespannt sein.
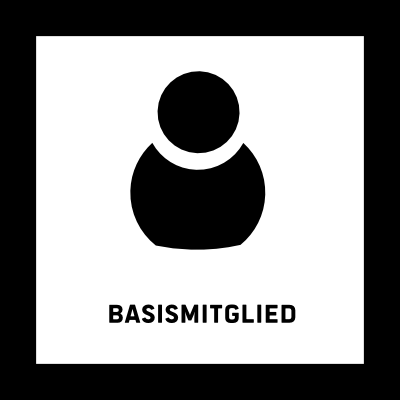 Basismitglieder haben keine besonderen Fähigkeiten oder Rechte und verbringen die Auszählpausen mit Essen, Gesprächen oder Partyspielen.
Basismitglieder haben keine besonderen Fähigkeiten oder Rechte und verbringen die Auszählpausen mit Essen, Gesprächen oder Partyspielen.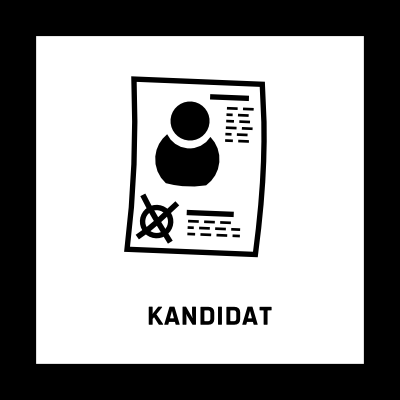 Auch eine Kandidatur bringt in dieser Phase keine speziellen Privilegien mit sich.
Auch eine Kandidatur bringt in dieser Phase keine speziellen Privilegien mit sich.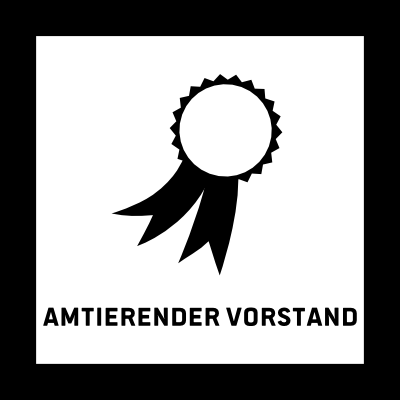 Zunächst können amtierende Vorstände ein Mitglied in der Mitgliederdatenbank nachschlagen und damit Einsicht in dessen Rollenkarte erhalten.
Zunächst können amtierende Vorstände ein Mitglied in der Mitgliederdatenbank nachschlagen und damit Einsicht in dessen Rollenkarte erhalten.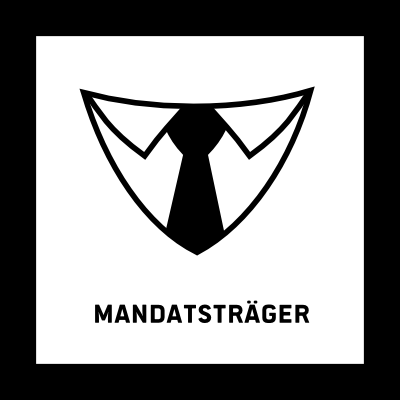 Mandatsträger können einzelne Mitglieder vor Austritt, Parteiausschluss und Hausverboten bewahren. Im Gegensatz zu anderen Rollen kann dabei jeder Mandatsträger einen anderen Spieler beschützen.
Mandatsträger können einzelne Mitglieder vor Austritt, Parteiausschluss und Hausverboten bewahren. Im Gegensatz zu anderen Rollen kann dabei jeder Mandatsträger einen anderen Spieler beschützen.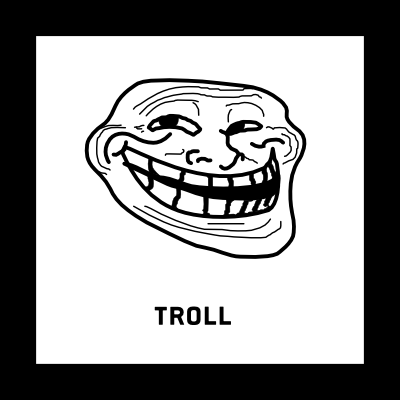 Dann haben die Trolle Gelegenheit, ein Mitglied zum Austritt zu bewegen. Die Rollenkarte des betroffenen Spielers wird vom Spielleiter eingesammelt. Handelt es sich um einen Kandidaten, können die Trolle bestimmen, wer an dessen Stelle nun kandidiert. Die Kandidaturkarte wird mit der leeren Rückseite zuoberst an ihren neuen Platz gelegt. Ist das betreffende Mitglied geschützt, schlägt die Trollerei fehl.
Dann haben die Trolle Gelegenheit, ein Mitglied zum Austritt zu bewegen. Die Rollenkarte des betroffenen Spielers wird vom Spielleiter eingesammelt. Handelt es sich um einen Kandidaten, können die Trolle bestimmen, wer an dessen Stelle nun kandidiert. Die Kandidaturkarte wird mit der leeren Rückseite zuoberst an ihren neuen Platz gelegt. Ist das betreffende Mitglied geschützt, schlägt die Trollerei fehl.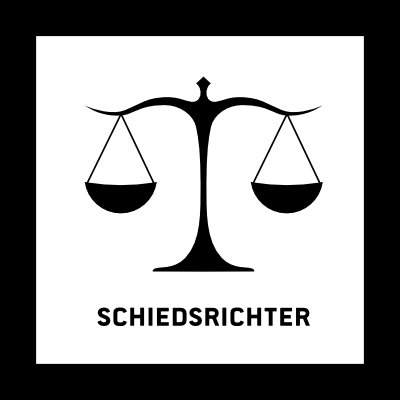 Nun tagt das Schiedsgericht und kann ein Parteiausschlussverfahren verhandeln. Auch dabei wird, sofern das Mitglied nicht durch Mandatsträger geschützt ist, die Rollenkarte des betroffenen Spielers eingesammelt und gegebenenfalls seine Kandidaturkarte umgedreht neu platziert.
Nun tagt das Schiedsgericht und kann ein Parteiausschlussverfahren verhandeln. Auch dabei wird, sofern das Mitglied nicht durch Mandatsträger geschützt ist, die Rollenkarte des betroffenen Spielers eingesammelt und gegebenenfalls seine Kandidaturkarte umgedreht neu platziert.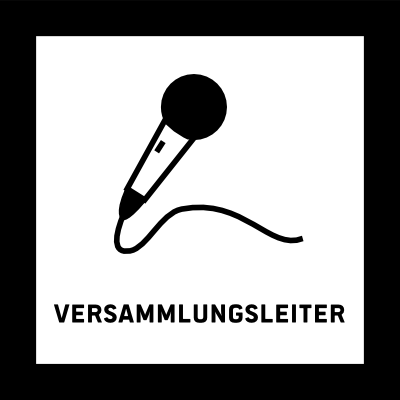 Versammlungsleiter können Hausverbote aussprechen, mit den gleichen Folgen wie Parteiausschluss und Austritt.
Versammlungsleiter können Hausverbote aussprechen, mit den gleichen Folgen wie Parteiausschluss und Austritt.
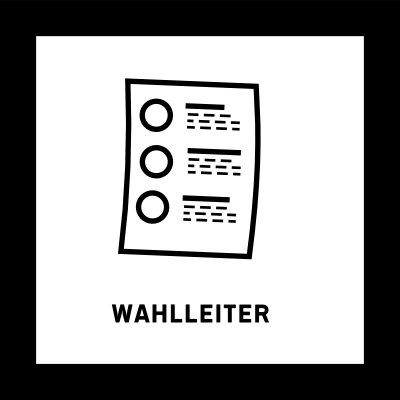 Zuletzt bekommen die Wahlleiter die Möglichkeit, die Kandidatenliste zu verändern. Dabei wird eine Kandidaturkarte – ob umgedreht oder nicht – von einem Spieler zu einem anderen transferiert.
Zuletzt bekommen die Wahlleiter die Möglichkeit, die Kandidatenliste zu verändern. Dabei wird eine Kandidaturkarte – ob umgedreht oder nicht – von einem Spieler zu einem anderen transferiert.